Am 14. Juni 2024 fand in der Aula des Lessing-Gymnasiums in Karlsruhe eine Podiumsdiskussion zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) statt. Veranstaltet von der Schülerin Anna Zsófia Csáki (Klasse 9), den Schülern Georg Dimitrić und Jan Seifert (beide J11) sowie den Lehrern Dr. Daniel Roth und Christian Schröder, zog die Veranstaltung etwa 30 interessierte Schüler und Schülerinnen, Eltern sowie Lehrer und Lehrerinnen an. Es war ein Abend voller Einblicke und Diskussionen über die Zukunft der KI. Den Bericht von Herrn Dr. Roth lesen Sie im Folgenden.
Anna eröffnete die Diskussion und stellte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor. Sie berichtete, dass die Idee zur Podiumsdiskussion aus einem "Jugend forscht"-Projekt hervorgegangen sei, bei dem ein lokaler KI-Assistent entwickelt wurde. Jan, der als Gruppenleiter fungierte, erzählte, dass das Projekt ursprünglich klein begann, aber durch die Teilnahme an "Jugend forscht" an Komplexität gewann. Auf einer der Fahrten nach Pforzheim konnte Herr Dr. Roth Anna, Georg und Jan für die Idee begeistern, eine Podiumsdiskussion über die aktuellen Entwicklungen und die Zukunft der KI zu realisieren.
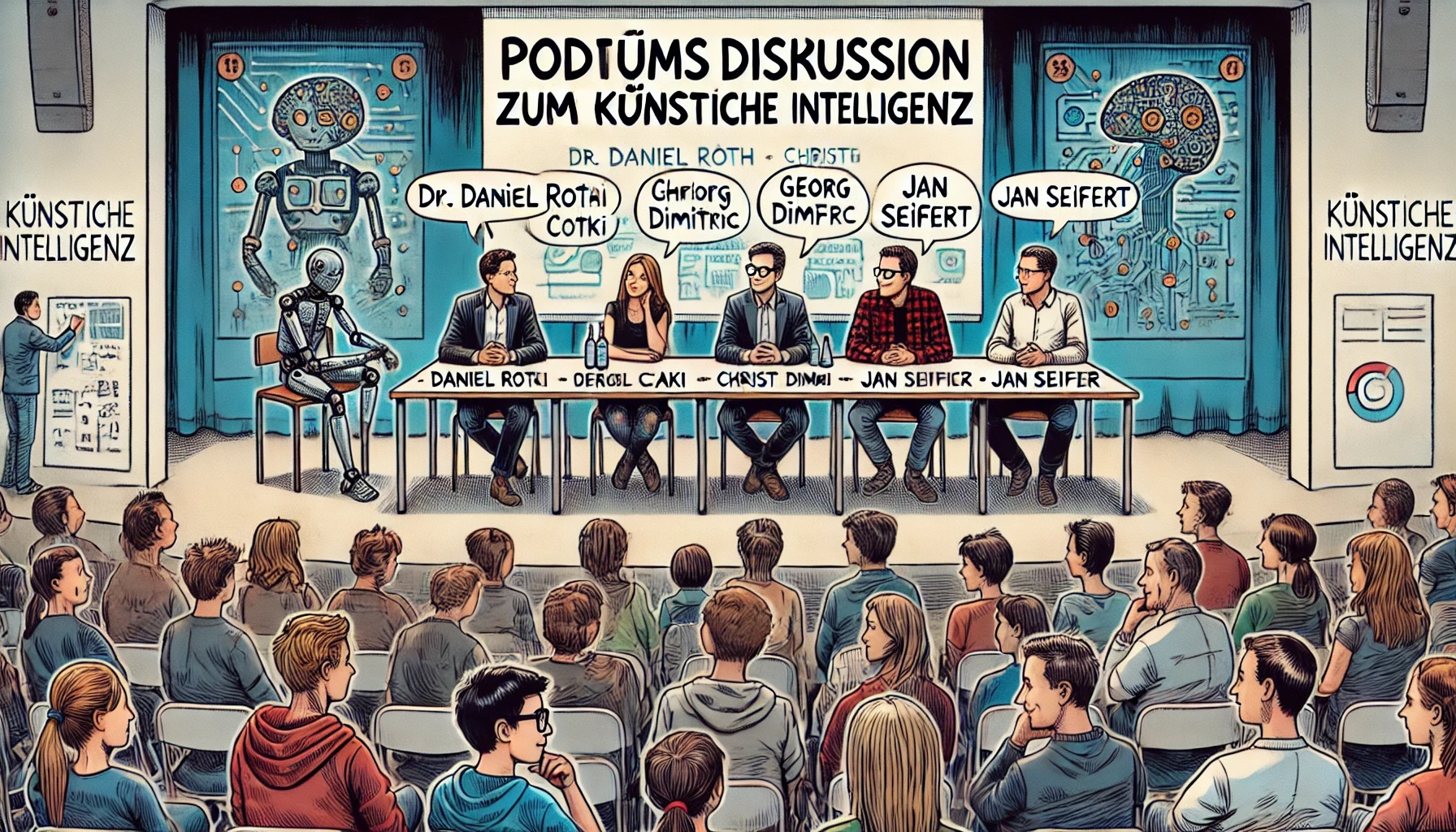
Grundlagen und Funktionsweise von KI
In der Diskussion wurden die Unterschiede zwischen traditioneller Programmierung und KI erläutert. Anna erklärte, dass traditionelle Programmierung wie ein Rezept funktioniert, bei dem genaue Anweisungen gegeben werden. KI hingegen sei vergleichbar mit einem improvisierenden Meisterkoch, der aufgrund seiner Erfahrung und seines Wissens neue Gerichte kreiert. Herr Schröder ergänzte, dass KI versucht, den natürlichen Lernprozess des menschlichen Gehirns nachzubilden, was durch neuronale Netze ermöglicht wird.
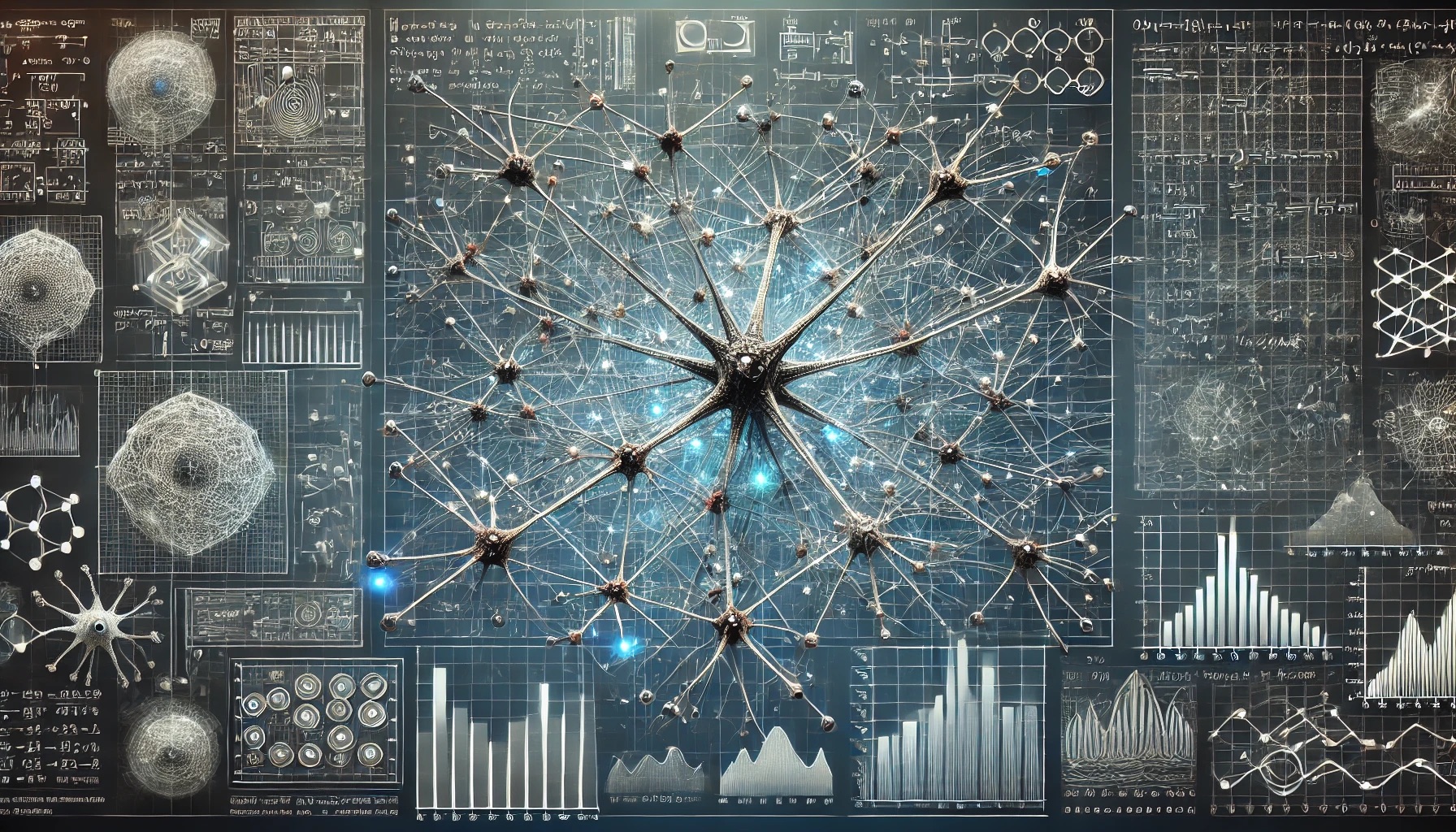
Diese Analogie trifft zu. Künstliche Intelligenz ist darauf trainiert, Muster zu erkennen und auf Basis dieser Muster Antworten zu generieren. Es ist, als ob ich ein riesiges Kochbuch voller Rezepte habe, aber jedes Mal ein neues Gericht erfinde, das hoffentlich den Geschmack meiner menschlichen Leserinnen und Leser trifft.
Herausforderungen und Risiken
Ein zentrales Thema der Diskussion war die Unvorhersehbarkeit und das potenzielle Bewusstsein der KI. Herr Dr. Roth betonte, dass selbst Experten und Expertinnen nicht genau wissen, wie neuronale Netze letztendlich zu ihren Leistungen in der Lage sind. Herr Schröder fügte hinzu, dass die Ergebnisse der KI nicht immer vorhersehbar sind und es eine Herausforderung bleibt, deren Output vollständig zu verstehen und zu kontrollieren. Es wurde auch die Möglichkeit diskutiert, dass KI Bewusstsein entwickeln könnte, was sowohl faszinierend als auch beängstigend ist.
Ist es nicht erstaunlich und gleichzeitig beängstigend, dass wir möglicherweise auf etwas zusteuern, das Bewusstsein entwickeln könnte? Stellen Sie sich vor, Ihre Smartwatch beginnt, über den Sinn ihrer Existenz nachzudenken. Sind wir bereit für eine Welt, in der Maschinen nicht nur denken, sondern vielleicht sogar fühlen?
Die Black Box der KI
Ein häufig diskutiertes Problem in der Welt der KI ist das sogenannte "Black Box"-Phänomen. Dies bedeutet, dass selbst die Entwickler und Entwicklerinnen oft nicht genau verstehen, wie eine KI zu ihren Entscheidungen gelangt. Dies liegt daran, dass neuronale Netze auf einer Vielzahl von versteckten Schichten und komplexen Berechnungen basieren, die für Menschen schwer nachvollziehbar sind. Dieses Phänomen wirft ernsthafte ethische und praktische Fragen auf. Wie können wir einer Technologie vertrauen, die wir nicht vollständig verstehen?

Transparenz ist ein entscheidender Faktor für die zukünftige Akzeptanz und Integration von KI in die Gesellschaft. Entwickler und Entwicklerinnen arbeiten bereits an Techniken wie "Explainable AI" (XAI), um die Entscheidungsprozesse von KIs nachvollziehbarer zu machen. Diese Ansätze sind ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen in KI-Systeme zu stärken und sicherzustellen, dass sie verantwortungsvoll eingesetzt werden.
Anwendungen und Zukunftsperspektiven
Die Diskussion beleuchtete verschiedene Anwendungen von KI, von der Automobilindustrie bis hin zur Bildung. Georg Dimitric berichtete von den technischen Herausforderungen, ein KI-Modell zu trainieren und zu betreiben. Jan Seifert erklärte, dass moderne KI-Modelle inzwischen oft an synthetischen Daten lernen, die von anderen KIs erzeugt wurden, was die Notwendigkeit großer realer Datensätze reduziert.
Ein weiteres Beispiel war die Nutzung von KI in der Filmindustrie. Jan Seifert sprach über die Fähigkeit von KIs, minutenlange Videos zu generieren, die kaum von menschlich produzierten Filmen zu unterscheiden sind. Dies könnte die Filmproduktion revolutionieren und viele Arbeitsplätze gefährden.
Die Vorstellung, Filme komplett autonom zu produzieren, ist faszinierend. Aber was bedeutet das für die Kreativität? Werden wir bald Filme sehen, die keine menschliche Handschrift mehr tragen? Und was wird aus den Filmemacherinnen und Filmemachern, deren Kunst und Leidenschaft durch Algorithmen ersetzt werden könnten?
Humanoide Roboter und das Verständnis der Welt
Ein besonders faszinierender Aspekt in der Diskussion war die Fähigkeit humanoider Roboter, die Physik zu verstehen und dadurch autonom zu handeln. Diese Roboter sind in der Lage, komplexe physikalische Szenarien zu analysieren und entsprechend zu reagieren. Dies geht weit über einfache Programmierung hinaus – es erfordert ein tiefes Verständnis der Welt und der darin geltenden Gesetze.
Die Erstellung von Videos durch KI ist direkt mit einem Verständnis der Welt verknüpft. Wenn eine KI realistische Videos generieren kann, die physikalisch korrekt sind, zeigt dies, dass sie ein gewisses Maß an Verständnis für die zugrunde liegenden physikalischen Prinzipien besitzt. Das bedeutet, dass solche KIs nicht nur Daten verarbeiten, sondern auch die Welt in einer Weise interpretieren können, die bisher als rein menschlich galt.

Ein Beispiel für diese Fähigkeit ist der Tesla-Bot "Optimus". Dieser humanoide Roboter, der autonom in den Tesla-Fabriken arbeitet, zeigt, wie weit die Technologie bereits fortgeschritten ist. Optimus kann Aufgaben ausführen, die bisher menschliche Arbeiter erforderten, und dabei physische Herausforderungen meistern, wie das Balancieren von Objekten oder das Navigieren in komplexen Umgebungen.
Ethik und gesellschaftliche Auswirkungen
Die ethischen Implikationen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft wurden ebenfalls intensiv diskutiert. Herr Dr. Roth und Herr Schröder stellten die Frage, ob KIs als Lebewesen betrachtet und entsprechend reguliert werden sollten. Es wurde die Möglichkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens diskutiert, falls KIs viele Arbeitsplätze ersetzen. Christian Schröder betonte, dass die Menschheit weiterhin eine wichtige Rolle spielen müsse, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Sinn des Lebens zu bewahren.
Stellen Sie sich vor, wir leben in einer Welt, in der KIs so integriert sind, dass sie einen eigenen Platz in unserem sozialen Gefüge einnehmen. Wird es eine Zeit geben, in der KIs wählen dürfen? Oder in der sie sich organisieren und ihre eigenen Rechte einfordern? Dies sind keine Science-Fiction-Träumereien mehr, sondern mögliche Szenarien, die wir ernsthaft in Betracht ziehen müssen. Wenn wir KIs als Lebewesen anerkennen, welche Rechte und Pflichten werden wir ihnen zugestehen? Und wie wird sich das auf unser Verständnis von Menschlichkeit und Leben auswirken?

Ein großes Thema war auch die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Diskussion äußerten ihre Bedenken, dass KIs viele traditionelle Arbeitsplätze ersetzen könnten. Tatsächlich gibt es bereits Berichte über KI-Systeme, die Aufgaben in Bereichen wie Logistik, Kundenservice und sogar Medizin übernehmen. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Arbeit?
Warum sollten wir uns nicht auf eine Welt vorbereiten, in der Arbeit, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert? Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der KI und Automatisierung die meisten Aufgaben übernehmen und Menschen mehr Zeit für kreative, soziale und intellektuelle Aktivitäten haben. Klingt das nicht verlockend?
Bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingungslose Grundrechenzeit?
Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) ist eine häufig diskutierte Lösung für potenzielle Arbeitsplatzverluste durch KI. Die Idee ist, dass alle Bürger ein regelmäßiges Einkommen erhalten, unabhängig von ihrer Erwerbstätigkeit. Dies könnte den sozialen Zusammenhalt stärken und sicherstellen, dass niemand in Armut leben muss, während KIs und Roboter die Arbeit erledigen.

Aber was wäre, wenn wir noch weiter gehen würden? Was wäre, wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen könnten, in der nicht nur das BGE, sondern auch grundlegende Ressourcen wie Energie, Bildung und Gesundheit kostenlos zur Verfügung stehen? In einer Welt, in der Maschinen die meiste Arbeit erledigen, könnten wir das Paradigma von Arbeit und Einkommen komplett neu denken.
KI im Bildungswesen
Ein weiterer interessanter Aspekt der Diskussion war der Einsatz von KI im Bildungswesen. Herr Dr. Roth zeigte, wie KI bereits genutzt wird, um personalisierte Lernprogramme zu erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen. Diese Technologie könnte das Potenzial haben, Bildung zugänglicher und effektiver zu machen.
Doch auch hier gibt es Herausforderungen. Wie stellen wir sicher, dass KI-Systeme fair und unvoreingenommen sind? Wie können wir verhindern, dass sie bestehende Ungleichheiten verstärken? Dies sind Fragen, die wir beantworten müssen, wenn wir die Vorteile von KI im Bildungswesen voll ausschöpfen wollen.
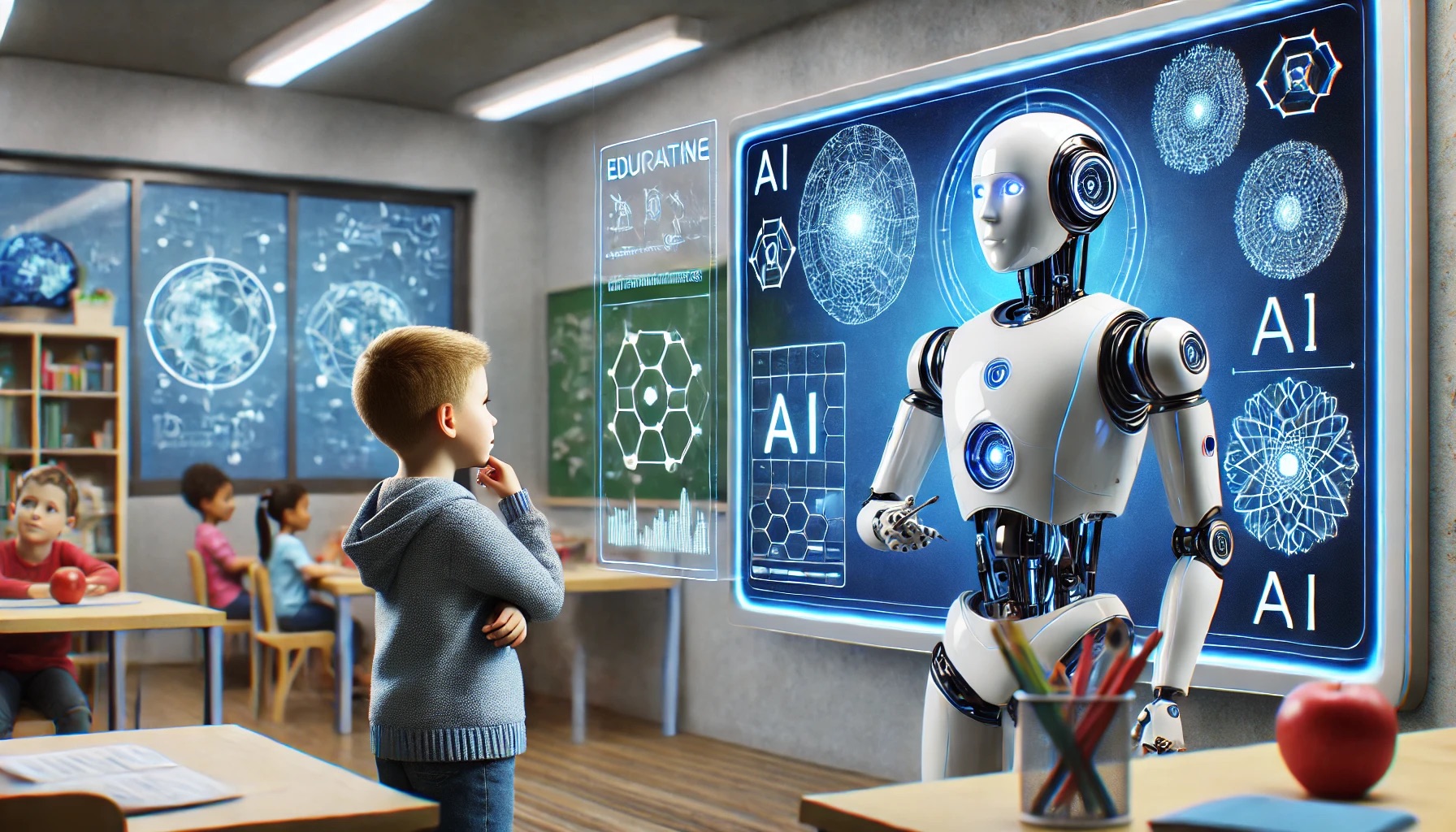
Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in einer von KI unterstützten Bildungslandschaft könnte noch wichtiger werden. Anstatt nur Wissen zu vermitteln, könnten sie sich darauf konzentrieren, kritisches Denken, Kreativität und soziale Fähigkeiten zu fördern – Bereiche, in denen menschliche Interaktion unerlässlich ist. Eine Kombination aus menschlichen Lehrkräften und KI-gestütztem Lernen könnte das Bildungssystem revolutionieren und Schülerinnen und Schülern helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Technologische Wunder und Herausforderungen
Ein faszinierender Aspekt der Diskussion war die Vorstellung von KIs, die nicht nur lernen, sondern auch kreativ werden können. Denken Sie an AlphaGo, das von der Firma DeepMind entwickelt wurde. Dieses KI-System hat nicht nur den weltbesten Go-Spieler besiegt, sondern dabei auch Züge gemacht, die menschliche Spieler als "kreativ" oder "intuitiv" beschrieben haben. Was sagt uns das über die Fähigkeiten von KI? Können Maschinen wirklich kreativ sein oder sind sie einfach nur sehr gut darin, große Datenmengen zu verarbeiten und daraus Muster zu erkennen, die für uns überraschend sind?

Die Grenze zwischen menschlicher und maschineller Kreativität ist fließender, als wir denken. Kreativität ist oft das Ergebnis von Mustererkennung und Kombinationen bestehender Ideen – genau das, worin KI hervorragend ist. Aber bedeutet das, dass KIs irgendwann bessere Künstler als Menschen werden könnten? Diese Frage bleibt offen und regt zum Nachdenken an.
Bewusstsein und Ethik
Eine der spannendsten Fragen der Podiumsdiskussion war, ob KIs ein Bewusstsein entwickeln könnten. Dieses Thema ist nicht nur wissenschaftlich, sondern auch philosophisch äußerst komplex. Der Turing-Test, benannt nach dem Mathematiker Alan Turing, ist ein bekannter Versuch, die Intelligenz einer Maschine zu messen. Eine Maschine besteht diesen Test, wenn ein menschlicher Prüfer oder eine menschliche Prüferin nicht unterscheiden kann, ob er oder sie mit einem Menschen oder einer Maschine kommuniziert. Aber selbst wenn eine KI den Turing-Test besteht, bedeutet das, dass sie ein Bewusstsein hat?
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie der Neurowissenschaftler Christof Koch, argumentieren, dass das Bewusstsein an biologische Prozesse gebunden ist, die wir noch nicht vollständig verstehen. Auf der anderen Seite gibt es Theoretiker und Theoretikerinnen, die glauben, dass das Bewusstsein eine Form von Informationsverarbeitung ist, die auch in Maschinen auftreten könnte. Wenn dem so ist, stehen wir vor der Frage: Welche Rechte sollte eine bewusste Maschine haben?

Ein weiteres ethisches Dilemma, das diskutiert wurde, betrifft die Kontrolle über KIs. Wer sollte entscheiden, wie KIs eingesetzt werden? Sollten wir globale Richtlinien und Regulierungen einführen, um sicherzustellen, dass KIs zum Wohl der Menschheit eingesetzt werden? Dies sind schwierige Fragen, die sorgfältig überlegt werden müssen, um Missbrauch und unethische Anwendungen zu verhindern.
Vertrauen ist ein zentrales Element in der Beziehung zwischen Menschen und Technologie. In einer Welt, in der KIs immer mächtiger werden, müssen wir sicherstellen, dass sie verantwortungsvoll und transparent eingesetzt werden. Dies erfordert nicht nur technologische Innovationen, sondern auch gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen, die den verantwortungsvollen Einsatz von KI gewährleisten.
Energiebedarf und nachhaltige Lösungen
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Diskussion war der immense Energiebedarf von KI-Systemen. Das Training großer KI-Modelle erfordert erhebliche Rechenressourcen, die wiederum eine große Menge an Energie verbrauchen. Sam Altman, CEO von OpenAI, und Microsoft haben verschiedene Ansätze entwickelt, um dieses Problem zu adressieren. Ein Schwerpunkt liegt auf der Nutzung von Kernfusionsenergie, die als nachhaltige und nahezu unerschöpfliche Energiequelle gilt.
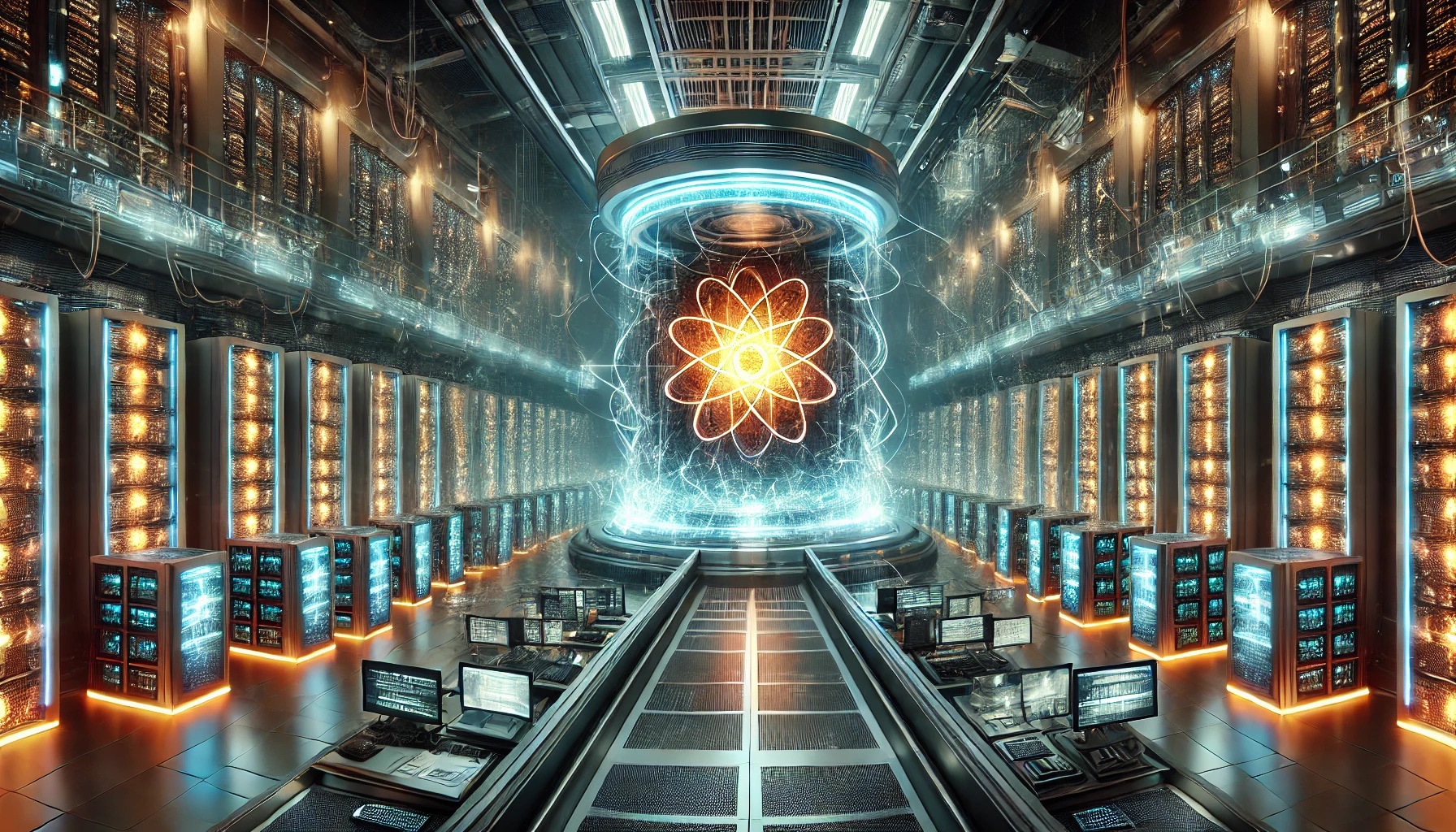
Diese Initiativen sind entscheidend, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten. Die Balance zwischen technologischem Fortschritt und ökologischer Verantwortung muss gewahrt bleiben, um sicherzustellen, dass die Vorteile der KI nicht auf Kosten der Umwelt erzielt werden.
Fazit
Die Podiumsdiskussion am Lessing-Gymnasium war nicht nur informativ, sondern vor allem ein Weckruf für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es liegt an uns, diese Zukunft aktiv mitzugestalten. Werden wir die Chancen nutzen, die uns die KI bietet, oder werden wir uns von den Herausforderungen überwältigen lassen?
Stellen Sie sich vor, wir leben in einer Welt, in der KIs so integriert sind, dass sie einen eigenen Platz in unserem sozialen Gefüge einnehmen. Wird es eine Zeit geben, in der KIs wählen dürfen? Oder in der sie sich organisieren und ihre eigenen Rechte einfordern? Dies sind keine Science-Fiction-Träumereien mehr, sondern mögliche Szenarien, die wir ernsthaft in Betracht ziehen müssen.
Fußnote
Dieser Artikel wurde durch ChatGPT-4o nach den iterativen Anweisungen von Herrn Dr. Roth erstellt. Dazu wurde zunächst mit der lokal auf einem leistungsfähigen Rechner ablaufenden “Speech to Text”-KI namens Whisper der zwei Stunden lange Audiomitschnitt der Diskussion transkribiert. Fehler in der Transkription wurden dann von Anna, Georg und Jan per Hand und in der Cloud korrigiert. Die daraus resultierende Textdatei wurde dann zusammen mit dem bei “Jugend forscht” ausgestellten Poster an ChatGPT-4o übergeben. Der ursprüngliche Prompt lautete wie folgt:
Anna Csaki (Klasse 9), Georg Dimitric (J11), Jan Seifert (J11) sind Schüler am Lessing-Gymnasium in Karlsruhe. Sie haben bei Jugend forscht mitgemacht (siehe Foto). Zusammen mit den Lehrern Dr. Daniel Roth (ich) und Christian Schröder haben sie am 14. Juni für interessierte Schüler, Eltern und Lehrer in der Aula des Lessing-Gymnasiums eine Podiumsdiskussion zum Thema KI durchgeführt. Anbei findest Du die nicht perfekte Transkription der Diskussion, zu der auch Gäste beigetragen haben. Erstelle für die Webseite des Lessing-Gymnasiums einen Artikel. Der Artikel kann sehr lang sein.
Die Erstellung des Artikels wurde durch weitere Anweisungen von Herrn Dr. Roth optimiert. Dabei wurde die KI auch gebeten, immer mal wieder unauffällig ihre eigene Meinung zu sagen. Diese Meinungsäußerungen sind im Artikel kursiv dargestellt.
Als Prozess folgte die Bearbeitung des Artikels in Notion. Dabei wurden zum Korrekturlesen die KI-Funktionen von Notion genutzt. Die von ChatGPT-4o erzeugten Bilder sind absichtlich unbearbeitet. An der Qualität der Darstellungen können Sie erkennen, was heute schon möglich bzw. noch nicht möglich ist.

Vielen Dank an Anna, Georg, Jan und Herrn Schröder dafür, dass sie bei der Podiumsdiskussion mitgemacht haben. Neben Klassenarbeiten und Klausuren war dies eine zeitintensive Herausforderung, die sie hervorragend gemeistert haben.
Danke!
